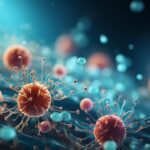Bildnachweis: ITM Isotope Technologies Munich SE, Titelbild Plattform Life Sciences-Ausgabe 2/2025.
Radiopharmazeutika, also Medikamente, die radioaktive Isotope zur Diagnose und Behandlung von Krebs einsetzen, eröffnen ein neues Kapitel in der Onkologie. Klinische Durchbrüche, regulatorischer Rückenwind und ein steigendes Investoreninteresse machen aus diesem ehemaligen Nischenfeld eine transformative Kraft in der Präzisionsonkologie. Europas Radiopharmaökosystem bietet eine exzellente Grundlage, um wissenschaftliche Innovationen strategisch in Anwendungen umzusetzen. Um die weltweite Spitzenposition zu behaupten, gilt es jedoch, weitere Herausforderungen zu meistern. Von Dr. Mark Harfensteller
Europa hat die Radiopharmazie maßgeblich geprägt: von der Produktion medizinischer Isotope bis hin zur Entwicklung bahnbrechender Therapien. Doch während die globale Nachfrage nach Radiopharmazeutika rasant wächst, stehen Unternehmen vor komplexen regulatorischen, logistischen und finanziellen Herausforderungen. Europa bietet eine hervorragende wissenschaftliche Infrastruktur, muss aber regulatorische Hürden überwinden, um seine Führungsrolle im internationalen Wettbewerb zu behaupten. Im Folgenden stehen fünf zentrale Bereiche im Fokus.
EU: Genehmigungen, Zulassungen und regulatorische Unsicherheiten

Der Transport radioaktiver Isotope über innereuropäische Ländergrenzen stellt Isotopenhersteller vor logistische Herausforderungen. Denn obwohl die EU in diesem Bereich eigentlich über gemeinsame Standards verfügt, erfordert der Transport radioaktiver Materialien in jedes Mitgliedsland eine separate Transportgenehmigung. Innerhalb der EU gilt das Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Zusätzlich hat jedoch jeder Mitgliedstaat eigene Regelungen für den Transport radioaktiver Stoffe erlassen, zu denen häufig die Pflicht zum Erwerb einer nationalen Transportlizenz gehört. Für eine Überführung – etwa von oder zu Isotopenherstellern oder Anwendern – muss das Transportunternehmen über gültige Lizenzen in allen durchfahrenen Ländern verfügen. Zusätzlich führen neue Sicherheitsvorschriften zu erheblichen personellen und dokumentarischen Mehraufwänden bei den Transportunternehmen. In Deutschland muss die SEWD-Richtlinie SiSoRaSt berücksichtigt werden, eine erweiterte Fassung der ursprünglich auf die Kerntechnik beschränkten Sicherungsrichtlinien für Kernbrennstoffe, die nun auch sonstige radioaktive Stoffe umfasst, die beispielsweise in der Medizin zur Anwendung kommen.
Die Einhaltung derartiger Vorschriften führt neben Kostensteigerungen auch zu einer Konzentration der zumeist von Kleinunternehmen geprägten Branche, da etliche Betriebe diesen Aufwand nicht leisten können. Eine mögliche Vereinfachung bestünde darin, dass eine in einem Mitgliedstaat erstellte Transportlizenz EU-weit anerkannt wird und die Sicherungsmaßnahmen auf den Minimalschutz gemäß ADR beschränkt werden, sofern es sich um kurzlebige Nuklide handelt und die Beförderung direkt unter ausschließlicher Verwendung erfolgt.
Ein weiteres Beispiel unterschiedlicher Regelungen innerhalb der EU ist die lokale pharmazeutische Überwachung – in Deutschland etwa durch die Regierungspräsidien. Diese führt aufgrund unterschiedlicher Auslegung der europäischen Regelwerke (GMP-Leitfaden) zu spürbaren Unterschieden in den Anforderungen, selbst innerhalb Deutschlands. Das hat teils erhebliche Standortvor- und -nachteile zur Folge. Harmonisierte EU-Zulassungsverfahren, einheitliche Leitlinien und transparente Vorgaben können administrative Hürden reduzieren, die Planungssicherheit erhöhen und Europas Wettbewerbsfähigkeit stärken und somit letztendlich Produkte, Patienten, Mitarbeiter und die Umwelt effektiv schützen.
Risiko: Engpässe in der Lieferkette
Zusätzliche logistische Herausforderungen ergeben sich aus den Halbwertszeiten radioaktiver Isotope. Radiopharmaka erfordern geeignete Radioisotope mit zumeist kurzer Halbwertszeit. Für Diagnostika kann diese im Bereich von Stunden liegen, bei Therapeutika in der Regel bei einigen Tagen. Jede Patientendosis wird daher mit der exakt berechneten Menge an Aktivität (also der erforderlichen Menge des Radioisotops) für einen bestimmten Behandlungszeitpunkt abgefüllt und muss rechtzeitig von der Produktionsstätte zum Behandlungszentrum transportiert werden. Die Wirksamkeit der Therapie hängt davon ab, dass das Arzneimittel rechtzeitig vorliegt und in der richtigen Stärke verabreicht werden kann. Radioisotope können aufgrund des radioaktiven Zerfalls nicht gelagert werden – daher erfordert der Herstelltungs- und Lieferprozess eine enge Taktung und hohe Präzision. Selbst kleinste Störungen in der Lieferkette können die Verfügbarkeit beeinträchtigen.

Das Radioisotop Lutetium-177 (Lu-177) – eines der am häufigsten eingesetzten therapeutische Radioisotope – wird durch Neutronenbestrahlung in Forschungs- und anderen Reaktoren hergestellt. Die Bestrahlung nimmt in der Regel mehr als eine Woche in Anspruch. Sobald die Probe aus dem Reaktor kommt, muss das Produkt aufgereinigt und versandfertig gemacht werden. Jeder Ausfall in der Lieferkette führt zu einem Versorgungsengpass. Insbesondere Forschungsreaktoren sind vorwiegend ältere Anlagen, die zwar gut gewartet werden, aber dennoch ein stetes Ausfallrisiko bergen. Fällt ein Reaktor aus, verzögert sich die Produktion von Lu-177, was Auswirkungen auf die gesamte nachfolgende Lieferkette haben kann.
Europäische Unternehmen arbeiten daran, die Produktion von Lu-177 auszubauen, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen. ITM Isotope Technologies Munich SE hat beispielsweise ein weltweites Reaktorennetzwerk etabliert, um bei solchen Ausfällen trotzdem reaktionsfähig zu bleiben und auf andere Reaktoren ausweichen zu können. Insbesondere hat ITM den Einsatz von Kernkraftwerken (CANDU-Reaktoren) zur Isotopenproduktion maßgeblich vorangetrieben, um die Versorgungssicherheit für Isotope wie Lu-177 nachhaltig zu sichern. Europa profitiert von seiner heterogenen Landschaft an Forschungsreaktoren und Forschungseinrichtungen und kann eine gute Versorgung der Isotope sicherstellen. Wichtig ist, diese Landschaft weiter zu erhalten, damit Europa bei diesen Radioisotopen ein Nettoexporteur bleibt.
Produktionsinnovation
Die Innovationen in der Isotopenproduktion in Europa sind entscheidend, um der wachsenden therapeutischen Nachfrage gerecht zu werden. Zu Beginn der aufkommenden radiopharmazeutischen Therapie wurde Lu-177 als „carrier added“ („c.a.“) eingesetzt. Diese weniger reine Variante enthält eine „langlebige“ Verunreinigung, Lu-177m, und bringt entsprechend höhere Abfallbelastungen für die Krankenhäuser mit sich. Da der Einsatz in der Prostatakrebsbehandlung ein vergleichsweise hohes Therapievolumen hat, sind reinere Isotope mit geringerer Abfallbelastung vorteilhaft. ITM hat daher vor ca. 20 Jahren das aufwendigere, aber deutlich reinere „non-carrier-added“ („n.c.a.“) Lu-177 entwickelt. Damit wurde der großflächige Einsatz von Lu-177 in der EU erst möglich. Investitionen in moderne Produktionsmethoden und fortschrittliche Isotopenaufbereitung ermöglichen skalierbare, reine Isotope und Radiopharmazeutika. Gleichzeitig können die Zusammenarbeit und der Wissensaustausch innerhalb Europas die Innovationsgeschwindigkeit erhöhen.

Kapitalbeschaffung und Investitionsklima
Um gezielt in vielversprechende Innovationen zu investieren, bietet die Kapitalbeschaffung für die Entwicklung und Skalierung von Radiopharmazeutika großes Potenzial. So kann ein förderliches Investitionsumfeld Wachstum beschleunigen und Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnen, etwa zur Skalierung der Produktion. Die radiopharmazeutische Branche erfordert im Vergleich zu anderen Bereichen der Biotechnologie höhere Anfangsinvestitionen, um Produktion und Lieferketten aufzubauen, weshalb langfristig orientierte strategische Investoren notwendig sind. Während es in Europa bereits erste Entwicklungen zur Gewinnung strategischer Investitionen gibt, besteht noch erhebliches Potenzial, diesen Bereich innerhalb Europas weiter auszubauen. Gezielte Anreize für Investitionen in den Life-Science-Sektor sowie attraktive Rahmenbedingungen für Venture Capital und Private Equity in Europa stärken die Entwicklung innovativer Therapien.
Fazit
Europa steht vor der Herausforderung, die regulatorischen Rahmenbedingungen für Radiopharmazeutika so zu modernisieren, dass es seine Vorreiterrolle im globalen Wettbewerb behaupten kann. Eine effizienzsteigernde Regulierung sowie harmonisierte Zulassungsverfahren, stabile Lieferketten wie auch klare Sicherheits- und Umweltvorgaben können dabei entscheidend sein. Auf diese Weise kann Europa Innovationen beschleunigen, die Patientenversorgung verbessern und internationale Investoren gewinnen.
ZUM AUTOR:
Dr. Mark Harfensteller ist Chief Operating Officer (COO) und Vorstandsmitglied der ITM Isotope Technologies Munich SE. Unter seiner Führung baute ITM eine industrielle, GMP-konforme Produktion auf, die den Anforderungen des dynamisch wachsenden Radioiotopenmarkts gerecht wird.
Autor/Autorin
Urs Moesenfechtel, M.A., ist seit 2021 Redaktionsleiter der GoingPublic Media AG - Plattform Life Sciences und für die Themenfelder Biotechnologie und Bioökonomie zuständig. Zuvor war er u.a. als Wissenschaftsredakteur für mehrere Forschungseinrichtungen tätig.